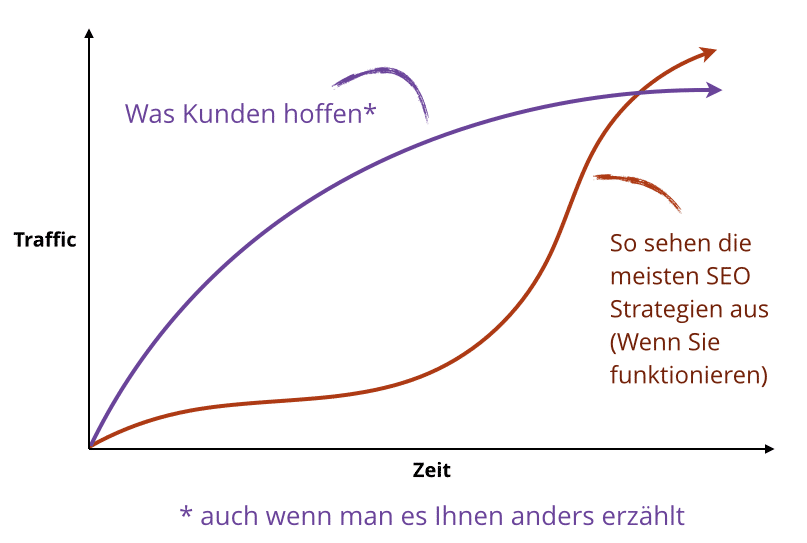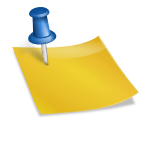Dies ist der erste Artikel einer neuen Reihe, in der ich ganz bewusst meinen Blick über den Tellerrand des SEO hinaus auf interessante Themen werfe, die mich dennoch in meiner täglichen Arbeit weitergebracht haben. Es soll nun also um Neuro-Rhetorik gehen – doch was ist das eigentlich?
Die Frage, was gute Texte ausmacht, dürfte so manchen unter Euch bereits beschäftigt haben. Es gibt unzählige Schreibratgeber und Texter-Tools, die zeigen wollen, wie man gutes Deutsch schreibt und was einen guten Stil ausmacht. Doch so richtig überzeugend finde ich das alles nicht. Über den grandiosen Podcast SWR2 Wissen: Aula bin ich auf das spannende Feld der Neuro-Rhetorik gestoßen, in dem sich Neurowissenschaftler damit beschäftigen, wieso das Gehirn bestimmte Satzstrukturen besonders verständlich findet, wann und wieso es auf manche Wörter besonders stark reagiert und auf andere wiederum kaum.
Der Kommunikationstrainer Markus Reiter beschreibt in der halbstündigen Sendung diesen Ansatz sehr anschaulich und verständlich:
Besonders spannend finde ich den Hinweis darauf, dass die Sprechfähigkeit der menschlichen Spezies bereits eine unglaubliche Leistung des Gehirns sei und die Kulturtechnik der Schrift und des Lesens im Grunde so neu, im Hinblick auf die Entwicklungsgeschichte der Menschheit, dass sich das Gehirn noch gar nicht evolutionär daran anpassen und optimieren konnte. Die Vermutung, dass wir nun Hirnareale zum Lesen verwenden, die früher für das Lesen von Spuren verwendet wurden, klingt in diesem Zusammenhang ebenso plausibel wie faszinierend.
Konkret für die Gestaltung wirkungsvoller Onlinetexte habe ich folgende Punkte für mich mitgenommen:
- Kurze Wörter und einfache Satzkonstruktionen lassen sich einfacher verarbeiten. Bei schwierigen Wörtern und komplizierten Sätzen springt das Auge öfter zurück, was das Lesen erheblich mühseliger macht. Das steht eigentlich in jedem Schreibratgeber. Aber es gibt ein weiteres, aus meiner Sicht sehr viel gewichtigeres Argument für kurze und prägnante Sprache, nämlich die sogenannte logographische Verarbeitung. Kurz gesagt gibt es (bei phonographischen Schriftsystemen) zwei Arten des Lesens: Die erste ist eine Wort-Bild-Verarbeitung. Chinesen beispielsweise lesen ein Wort, indem sie es als Bild(-zeichen) erkennen. Das Gehirn greift dabei sofort auf das mentale Lexikon zurück. Obwohl Deutsch und auch Englisch eigentlich Lautschriften sind, basiert ein Großteil unseres Lesens auf dem gleichen Prinzip. Wir erkennen die Worte als Zeichen. Das ist der Grund, warum wir Texte auch dann verstehen, wenn bei den Worten nur der erste und letzte Buchstabe stimmen, die restlichen aber vertauscht sind. Das funktioniert allerdings nur, solange wir das Wort auch tatsächlich als Bild gespeichert haben. Lange und komplizierte Ausdrücke wie „Suchmaschinenoptimierungsleitfaden“ oder „Donaudampfschifffahrtskapitän“ sind nicht in unserem Bildgedächtnis abgelegt. Diese müssen wir auf eine zweite, aufwändigere Art lesen. Hier lesen wir uns innerlich das Wort vor und verarbeiten, was wir quasi hören.
- Konkrete Begriffe vor abstrakten Begriffen. Wir verstehen bei Äpfel, Birnen, Zitronen und Bananen viel schneller, um was es geht, als bei Obst oder Früchten. Einfach und eingängig. Wer wissen will, wieso und was assoziative Begriffe wie „Knoblauch“, „Zimt“ oder „Jasmin“ auch für andere Sinne bedeuten, sollte unbedingt den Podcast hören.
- Bildorientiertes Lesen mittels Storytelling unterstützen. An Beispielen aus „Aschenputtel“ von den Brüdern Grimm und einem Absatz aus „Gablers Wirtschaftslexikon“ wird im Podcast sehr schnell klar, was begriffsorientiertes Lesen von bildorientiertem Lesen unterscheidet und welche Vor- und Nachteile mit den beiden Konzepten einhergehen. Kurz gesagt, das bildorientierte Lesen, das bei einem Roman ausgelöst wird, lässt von der ersten Zeile an Bilder in unserem Kopf entstehen. Diese Art des Lesens entfaltet im Gehirn eine Geschichte und triggert unsere Vorstellungskraft. Das begriffsorientierte Lesen, wie im Lexikon, wird eher systematisch ausgewertet und in einen rationalen Zusammenhang gestellt. Das trägt aber eben auch dazu bei, das sprachlich verfügbare, explizite Wissen zu erweitern.
- Priming und Framing wirken und lassen sich auch im Guten verwenden. Ich glaube, dass hier ein enormes Potenzial verborgen liegt, das es noch zu heben gilt. In der Politik ist Framing längst eines der mächtigsten Werkzeuge und auch Priming muss nicht aus der Mentalisten-Ecke kommen, sondern kann sinnvoll und ethisch unterstützend eingesetzt werden.
- Aktiv und Passiv haben beide eine Daseinsberechtigung! Hier findet sich der größte Widerspruch zu gängiger Schreibratgeber-Literatur und auch viele Text-Analyse-Werkzeuge markieren den passiven Satzbau als verbesserungswürdig. Neurowissenschaftlich lässt sich jedoch kein genereller Vorteil von aktiver gegenüber passiver Sprache erkennen. Beide werden gleich schnell und gleich gut verarbeitet – allerdings legen beide Satzkonstruktionen unterschiedliche Schwerpunkte, betonen also andere Dinge in einem Satz.
Und was sagt Ihr dazu? Irgendwas Neues gelernt? Was Überraschendes dabei? Gefallen Dir derartige Artikel? Mehr davon? Dann ab damit in die Kommentare oder abonniere meinen Newsletter!
Das Artikelbild ist von Peter Wolber selbst gezeichnet, CC BY-SA 3.0, Link
Abonniere das kostenlose KI-Update
Bleib auf dem Laufenden in Sachen Künstliche Intelligenz!
Melde Dich jetzt mit Deiner E-Mail-Adresse an und ich versorge Dich kostenlos mit News-Updates, Tools, Tipps und Empfehlungen aus den Bereichen Künstliche Intelligenz für dein Online Business, WordPress, SEO, Online-Marketing und vieles mehr.
Keine Sorge, ich mag Spam genauso wenig wie Du und gebe Deine Daten niemals weiter! Du bekommst höchstens einmal pro Woche eine E-Mail von mir. Versprochen.